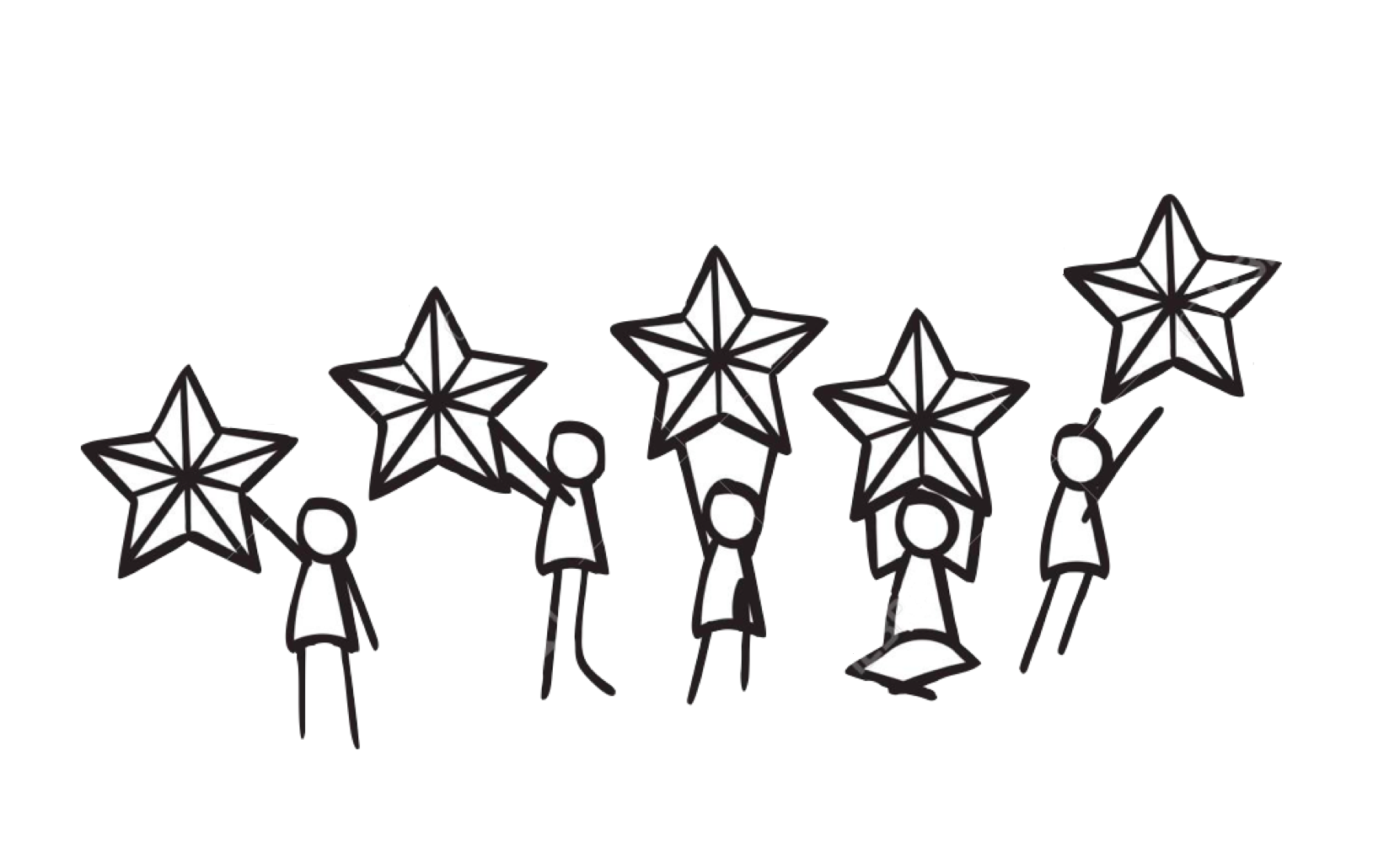Was man aus der Beurteilung von Mitarbeitenden für die schulische Beurteilung ableiten kann
Unternehmen verändern die Bedingung für die Beurteilung von Mitarbeitenden laufend, um Erkenntnisse über die Funktionsweise dieser Beurteilung umzusetzen. Diese flexible Anpassung dürfte aus zwei Gründen aufschlussreich für schulische Beurteilungsprozesse sein: Erstens folgen diese Prinzipien, die seit Jahrzehnten festgeschrieben sind. Die Funktionsweise und Legitimation schulischer Beurteilungskultur erfolgt sehr stark über die Tradition, nicht über wissenschaftliche Evidenz. Zweitens sind Unternehmen daran interessiert, dass Mitarbeitende möglichst produktiv sind. Entsprechend setzen sie Beurteilungen ein. Produktivität ist nicht per se ein Ideal, das die Schule verfolgen sollte, aber es würde nicht schaden, Prüfungskultur dahingehend zu überprüfen, ob die tatsächlich die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Lernenden fördert oder sie beschneidet.
Deshalb einige Erkenntnisse aus der Mitarbeitendenberuteilung der letzten Jahre – und einige Anmerkungen zur Umsetzung in der Schule.
- Gespräche
Ein elementarer Bestandteil der Beurteilung von Mitarbeitenden sind Gespräche, in denen Beurteilende und Beurteilte sich austauschen und ihre Perspektiven vergleichen. Solche Gespräche finden teilweise auch an Schulen statt, zu oft läuft die Beurteilung aber über scheinbar harte Fakten wie Punkte, Kriterien oder Prüfungen, bei denen die Sichtweise der Lernenden keine Rolle spielt. - Zielvereinbarung als Grundlage
Die Beurteilung von Mitarbeitenden geht von Zielen aus, die gemeinsam festgelegt werden. Diese Ziele geben Mitarbeitenden im Idealfall Sicherheit und Orientierung (teilweise sind Performance-Ziele an den Erfolg von Abteilungen gebunden, welche einzelne Mitarbeitende gar nicht direkt beeinflussen können).
Ziele sind in der Schule zu oft implizit und für alle Lernenden identisch. Hier könnte sich die schulische Beurteilungspraxis massiv verbessern, wenn Bereiche einer individuellen Zielvereinbarung unterstellt würden, in denen dann auch individuelle Bewertungsnormen zum Tragen kämen. - Eigenverantwortung
Mitarbeitende sind für wesentliche Aspekte der Beurteilung selber verantwortlich (fürs Formulieren der Ziele, für die Information über die Zielerreichung etc.).
In der Schule sind Lernende zu oft passiv, sie unterziehen sich einem Bewertungsvorgang, an dem sie wenig Anteil haben. - Mehrdimensionale Ansätze
Bewertung findet in vielen Unternehmen in mehrere Richtungen statt. Peer-Feedback und und Bewertung von Vorgesetzten gewinnen an Bedeutung.
Solche Ansätze gibt es auch in der Schule, sie werden aber noch sehr zögerlich umgesetzt. Zu stark ist die Vorstellung, dass eigentlich nur eine ausgebildete Lehrperson beurteilen kann, ob Schüler:innen ihre Ziele erreichen. Zudem halten zuweilen starke Ängste einige Lehrende davon ab, Schüler:innen in die Beurteilung ihrer eigenen Lehrtätigkeit einzubinden. Gerade das würde aber Lernenden viel Vertrauen in die Beurteilungskultur schenken. - Zukunftsorientierung
Gute Beurteilungsprozesse von Mitarbeitenden sind auf die Planung künftiger Prozesse fokussiert, sie helfen dabei, besser zu arbeiten. Der Rückblick wird nur so stark eingebunden, wie er beim Blick in die Zukunft hilft. Man kann sagen: Mitarbeitendenbeurteilung ist stark formativ geworden.
Diesen Anspruch haben auch viele schulische Prozesse der Beurteilung, können ihn aber nur zögerlich einlösen. - Personalisierung der Beurteilungsformate
Unternehmen haben gemerkt, dass nicht alle Mitarbeitenden mit denselben Instrumenten und Formaten beurteilt werden sollten. Das ist abhängig von den Aufgaben und der Persönlichkeit der Mitarbeitenden.
Hier sind Schulen kaum lernfähig. Das hat systemische Gründe: Weil Schulen oft Selektion und Allokation betreiben müssen, gehen sie davon aus, diese Prozesse müssten für alle Schüler:innen identisch ablaufen. - Integration von Soft Skills
Unternehmen haben gemerkt, dass Kommunikationsfähigkeiten, Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Lernen sowie Führungsqualitäten wichtige Elemente sind, die sich nicht immer in messbaren Daten niederschlagen. Entsprechend setzen sie Beurteilungsverfahren so auf, dass sie Soft Skills berücksichtigen können.
Das passiert teilweise auch bei Zeugnissen, die Soft Skills erfassen – wird aber noch zu stark durch Noten in den Hintergrund gedrängt. Viele Schüler:innen agieren solidarisch, reflektiert, selbstkompetent, sie helfen einer Klasse dabei, sich wohlzufühlen – ohne dass das Niederschlag in ihren Noten findet.
Ich habe für diesen Beitrag mit einer Quellensammlung und Zusammenfassung von Perplexity gearbeitet, die hier zugänglich ist.