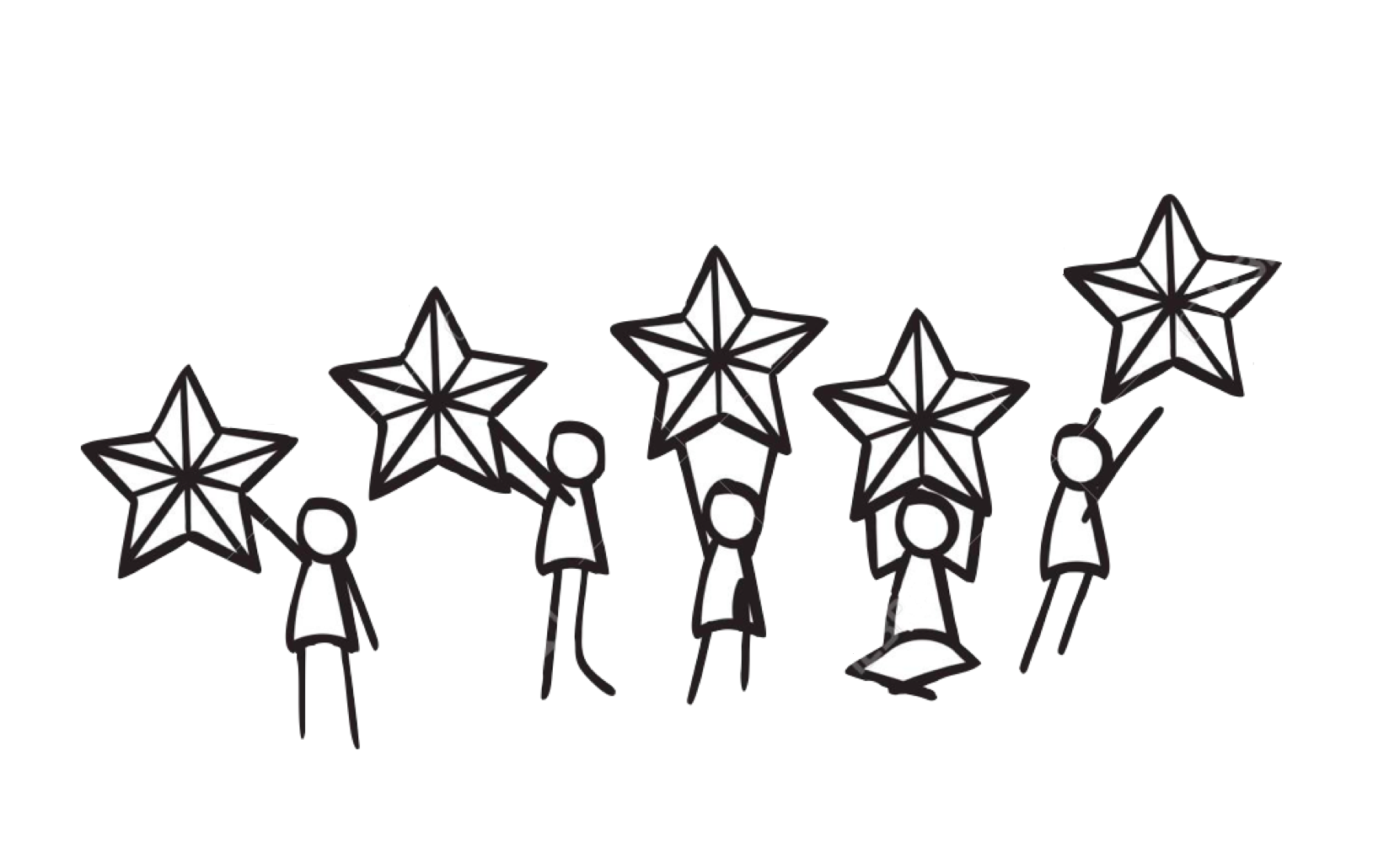Noteninflation – und was sich dagegen tun lässt
Die Vorstellung, es gebe bei Noten eine Inflation, zeigt, wie stark Noten als eine Währung gesehen werden. Gemeint ist damit laut Wikipedia der Vorgang, bei dem
für gleiche Leistungen von Schüler:innen oder Student:innen in Prüfungen über die Jahre zunehmend bessere Zensuren vergeben werden. Damit werden die erzielten (guten) Schulnoten entwertet – vergleichbar mit einer Inflation im Finanzwesen.
Wenn Noten die Basis für Selektionsprozesse im Bildungssystem sind – wie das in Deutschland beim Abitur oder bei den Staatsexamen der Fall ist –, dann ist der durch Noteninflation bezeichnete Prozess mit einer Ungerechtigkeit verbunden: Je nachdem, wo die Inflation stattfindet, werden Zugänge entweder im historischen oder geografischen Vergleich einfacher. Diese Ungleichheit ist ungerecht. In Deutschland könnten, gäbe es eine Noteninflation, plötzlich mehr Menschen studieren als das früher der Fall war – oder in Bundesländern ohne Inflation.
Ob es eine Noteninflation tatsächlich gibt, ist nicht ganz einfach zu beurteilen, wie z.B. dieser Faktencheck zu den Abiturnoten in Deutschland zeigt. Das Problem: Die Vergabe von Noten ist von vielen Faktoren beeinflusst, während sich die «Leistung» der Schüler:innen nicht objektiv vergleichen lässt. Wenn wir nur die Notendurchschnitte anschauen und sagen, dass die sich in einem Zeitraum verbessert haben, lässt sich daraus nicht ableiten, dass sich nicht auch das verbessert hat, was mit diesen Noten bewertet wird.
Ein aktueller Artikel aus The Atlantic diskutiert die Noteninflation an amerikanischen Elite-Colleges. Die Autorin formuliert darin die These, dass eine geringe Aktivität von Lernenden, der dabei empfundene Stress und Noteninflation verbunden seien. Die Colleges haben teilweise bewusst den Notendruck gesenkt, damit die psychische Belastung für Studierende bewältigbar ist. Da aber ein konstanter Konkurrenzdruck herrscht, zumindest an Elite-Unis, suchen die Studierenden neben den Noten Wege, um sich von anderen abzuheben. Die besseren Noten führen also zu einem anderen Druck, sich nämlich ausserhalb des Unterrichts zu beweisen.
Damit lässt sich auch mein Eindruck verbinden, dass der grösste Widerstand gegen mein System mit den Kompetenzrastern von den guten Schüler:innen kommt, die in einem Prüfungssystem bessere Leistungen als andere erzielen.
Wenn nun Noteninflation erstens ungerecht und zweitens zu Stress führt – was lässt sich dagegen tun?
- Die Vergabe von Noten lässt sich steuern. Vorschläge sind:
a) Bandbreiten, in denen Durchschnitte liegen müssen, um so Noten zu normieren
b) im Zeugnis steht nur die Abweichung nach oben (oder unten) vom relevanten Durchschnitt (damit spielt es keine Rolle mehr, wie gut die einzelne Note ist oder wie hoch die Noten in einem Bundesland ausfallen)
c) bestimmte Noten werden limitiert (z.B. dürfen maximal 20% eine Note mit einer 1 vor dem Komma erhalten).
d) die Notenskalen so ändern, dass die Erwartungen nicht mehr greifen (also z.B. in den USA statt A, B, C zu Zahlenwerten übergehen oder in Deutschland statt 15 Punkten oder 1, 2, 3 eine Skala mit 100 Punkten nutzen). - Selektion nicht von Noten abhängig machen, sondern von Qualifikationen, bei denen pass/fail-Systeme oder Quoten greifen. Letztlich geht es ja darum, beschränkte Plätze zu vergeben, wenn die Nachfrage grösser als das Angebot ist.
- Neben Qualifikationen Losverfahren einsetzen, wenn es mehr Qualifizierte als Plätze gibt – wie das Sandel vorschlägt.