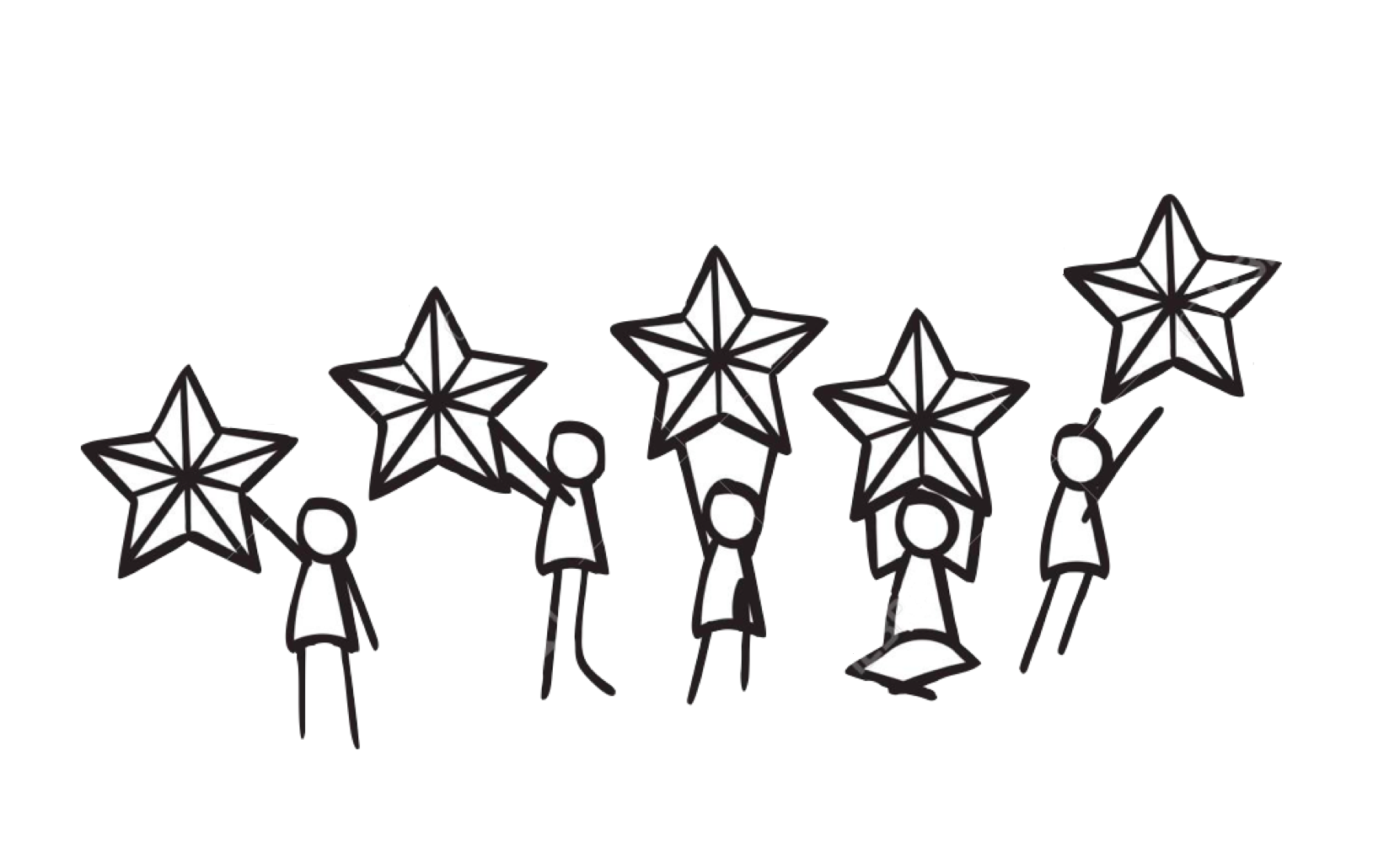Zwischennoten und Notenstände – eine Kritik
An Schweizer Gymnasien gibt es zwei widersprüchliche Tendenzen: Die Bildungspolitik strebt einerseits grössere Beurteilungszeiträume an, in der Regel ein Jahr. Zeugnisse werden nur noch einmal pro Jahr ausgestellt, was den Prüfungsdruck und die Ungenauigkeit von einzelnen Prüfungsresultaten reduziert. Schulen regen andererseits Lehrpersonen zu kürzeren Beurteilungszeiträumen an: Prüfungsnoten sollen so schnell wie möglich in einem Online-Tool erfasst werden, verbindliche Zwischenbeurteilungen führen zu Quasi-Zeugnissen, welche schon nach einem Quartal ausgestellt werden (allerdings ohne rechtliche Kraft).
Diese zweite Tendenz entspricht dem Bedürfnis von Schüler:innen, ihre aktuellen Noten wie einen Aktienkurs oder Kontostand ständig zu kennen, zu wissen, «wo sie stehen». Das ist oft auch eine Erwartung von Lehrpersonen, die an Schüler:innen herangetragen wird: Sie sollen Verantwortung für ihre Noten übernehmen und sich zumindest notieren, welche Noten sie erhalten haben, um ein Gefühl dafür zu erhalten, ob sie die Bestehensbedingungen erfüllen oder nicht.
Dieses Gefühl wird auf abstrakte Berechnungsvorgänge verlagert. Schüler:innen nutzen meist eine App, die ihnen sagt, ob sie «im Plus» sind, wie sie das ausdrücken. Wer sich im Plus befindet, kann lockerer an schulische Aufgaben herangehen, muss weniger Aufwand für Prüfungsvorbereitungen leisten.
Wird ein negativer Promotions- oder Versetzungsentscheid gefällt, kann die Schule darauf verweisen, dass Schüler:innen ja genau wussten, wie sie stehen. Die Zwischenberichte dokumentieren das auf die juristisch gültige Weise.
Warum soll das ein Problem sein? Die ungenauen und teilweise auch willkürlichen Noten werden natürlich gemacht: Sie werden bei Schüler:innen zu etwas Emotionalem, was ihren Alltag prägt und permanent im Bewusstsein ist. Jede Prüfung verändert die Punktzahl, mit jeder Note kann man «ins Minus» gelangen. Die über Noten gefällten Entscheidungen müssen nicht mehr begründet werden, durch die kleinteiligen Rückmeldungen sind sie schon legitimiert, alle wussten ja schon längst, dass das so nicht reicht.
Schüler:innen sollten an Schulen Lernerfahrungen machen, ihre Emotionen sollten sich auf Selbstwirksamkeitserfahrungen, Neugierde und das Verständnis der Welt und der Gesellschaft beziehen – nicht auf den Notenstand. Lehrpersonen sollten pädagogische Entscheidungen fällen. Der permanente Bezug auf den Notenstand erlaubt es ihnen, diese Entscheidungen als Berechnungen erscheinen zu lassen. Lernende wie Lehrende verlieren durch Noten aus dem Blick, was Lernerfahrungen bedeuten und was sie begünstigt. Sie tun so, als wären Zahlen wichtig, die bei Prüfungen entstehen.
Aus meiner Sicht wären Modelle besser, bei denen Schüler:innen und Lehrpersonen in möglichst langen Phasen ohne Noten lernen können. In den Momenten, in denen Entscheidungen nötig sind, werden dann Noten gesetzt, die vom Gesetz vorgeschrieben sind. Entscheidungen können so verdeutlicht und expliziert werden. Noten ersetzen aber Entscheidungen nicht und Schüler:innen müssen Noten auch nicht verinnerlichen. Sie sollten lernen können, ohne ständig befürchten zu müssen, dass ihre Zahlen nicht ausreichen.