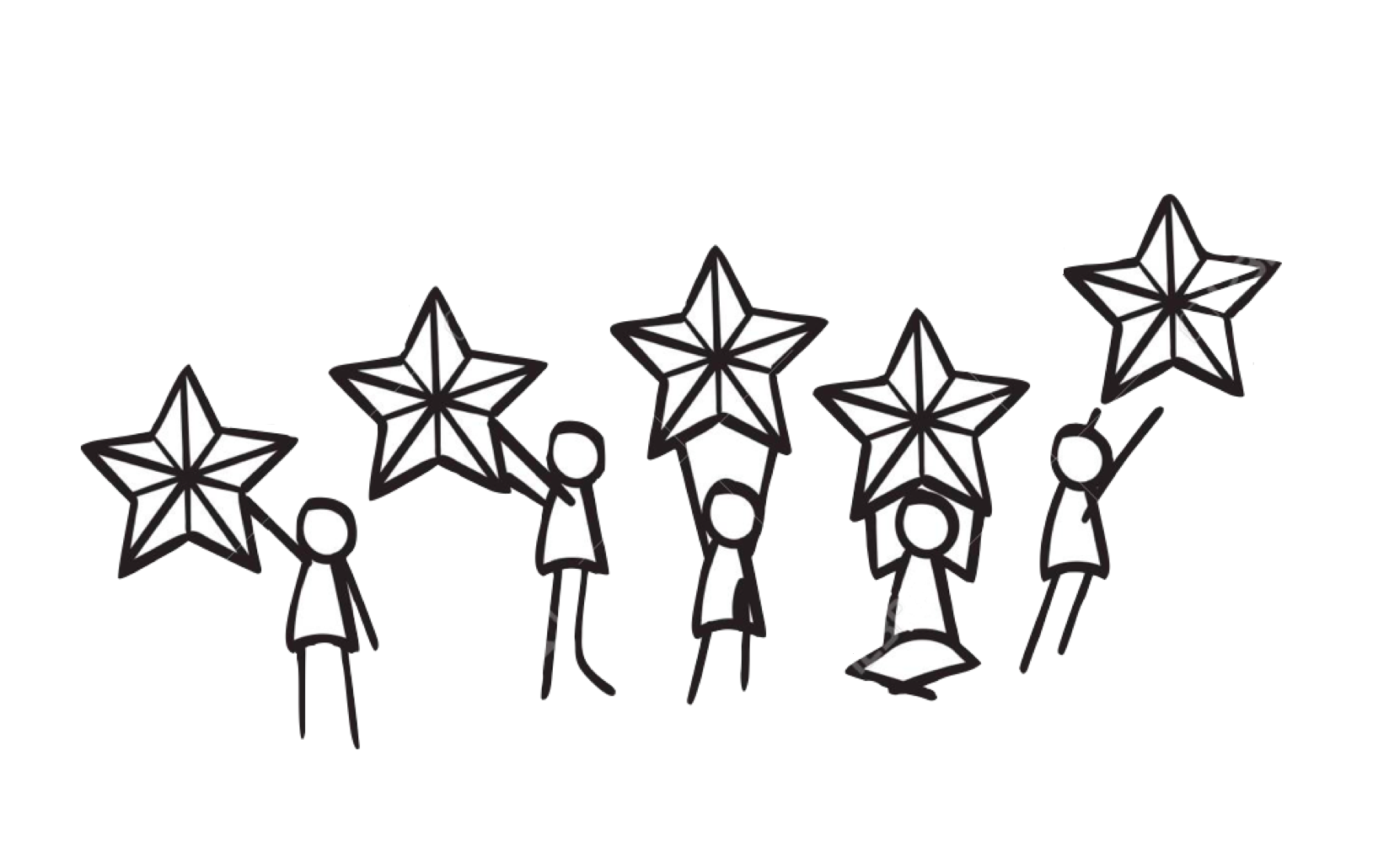Warum schreibt die Politik Schulen vor, Noten geben zu müssen?

Kürzlich hat sich im Kanton Aargau ein Vorgang wiederholt, der vor knapp drei Jahren schon im Kanton Zürich stattfand: Das kantonale Parlament hat Schulen vorgeschrieben, Noten geben zu müssen. Diese Reaktion auf die Anstrengungen von Schulen, ihre Lernkultur von Noten zu befreien, ist schwer verständlich, zumal es in den Erziehungswissenschaften einen breiten Konsens darüber gibt, das Noten zumindest in Aspekten problematisch sind und Lernprozesse belasten.
Grundsätzlich ist es ein Demokratiedefizit, wenn Entwicklungen, die von Fachkräften zum Wohle von Kindern angestoßen werden, von gewählten Politiker:innen eingeschränkt oder gar verboten werden können. Die Ausrede, es gäbe halt verschiedene Ansichten und durchaus auch Fachpersonen, die Noten nicht so schlecht fänden, halte ich nicht für überzeugend: Wenn es verschiedene Ansichten gibt, dann könnte man Schulen den Freiraum einräumen, die Lösung umzusetzen, welche die Verantwortlichen für sinnvoll halten. Erstaunlich ist, dass gerade die Politiker:innen, die gegen Bürokratie und für Freiheit sind, Schulen den bürokratischen Aufwand der Notensetzung per Gesetz vorschreiben.
Grundsätzlich ist es nicht ganz einfach zu verstehen, weshalb das geschieht. Von Noten wegzukommen ist ein Fortschritt, viele Menschen haben unter schulischer Bewertung gelitten und müssten leicht nachvollziehen können, warum es sinnvoll ist, neue Formen von Rückmeldungen zu finden. Ganz ähnlich wie es für Menschen, die schon einmal in einem Raucherabteil Zug gefahren sind, einleuchtend ist, Züge rauchfrei zu halten.
Perspektive 1: Schule soll so sein, wie die eigene Schule war
Das Festhalten an Noten ist ein Reflex vieler Menschen, welche die eigene Schulerfahrung verabsolutieren und sie auch rechtfertigen. Diese Menschen sehen ihre berufliche Karriere und ihre Biografie als stark von einer bestimmten Schulform geprägt an. Sie denken, sie verstünden, warum das alles so sein musste, haben für sich verarbeitet, dass sie die Aufnahme ins Gymnasium geschafft oder nicht geschafft, dass sie studieren konnten oder nicht studiert haben – und dass es an Schulen Prüfungen und Noten gab. Sie möchten deshalb, dass Schule so bleibt, wie sie war. Eine Schule ohne Noten ist für sie undenkbar, weil sie selber Schule anders erlebt haben. Deshalb verbieten sie diese Entwicklung.
Perspektive 2: Der Glaube an die Meritokratie
Die Idee der Meritokratie ist historisch eng mit schulischen Prüfungen verbunden. Man kann etwas zugespitzt sagen: Ohne Noten wird die Idee problematisch, dass Menschen im Leben das erhalten, was sie verdienen. Bei Löhnen ist es offensichtlich nicht so – Pflegefachpersonen sollten mehr Lohn erhalten, weil sie mehr leisten; Crypto-Investor:innen sollten weniger verdienen, weil sie nichts leisten. Die Politiker:innen, die sich für Meritokratie einsetzen, treten auch für Ideen ein, die sich damit nicht verbinden lassen: Gegen Erbschaftssteuern etwa oder für staatliche Subvention von bestimmten Unternehmen. Der Trick dieser Politiker:innen ist, soziale Ungerechtigkeiten als Problem nicht zu anerkennen, sondern Menschen ihre schlechteren Chancen oder Lebensbedingungen zuzuschreiben, indem sie diese als «verdient» bezeichnen. Gleichzeitig können Reiche und insbesondere Über-Reiche sich der unabdingbaren Solidarität entziehen, weil man ihre schädliche Anhäufung von Vermögen zirkulär auf eine Leistung bezieht, aus der sie entstanden sein musste.
Nur in der Schule gibt es eine reine Meritokratie, weil sie künstlich erzeugt wird. Die Schule kann über Prüfungen quasi frei bestimmen, was eine «Leistung» ist und diese mit Noten belohnen. Die beste Vermittlung dieser Ideologie erfolgt deshalb in der Schule. Der Zwang zu Noten muss deshalb erfolgen, damit schon Kinder daran glauben, dass «Leistung» belohnt wird und Benachteiligungen nur Menschen treffen können, die daran selbst die Schuld tragen. Ohne die Schule gäbe es viel mehr Widerstand gegen diese hässliche und unfaire Sichtweise auf Gesellschaft und Menschen.
Perspektive 3: Widerstand gegen individualisierte Lernwege
Schweizer Grundschulen verzichten deshalb zunehmend auf Noten, weil sie Lernen individualisiert haben. Lehrpersonen merken, dass Kinder unterschiedlich schnell lernen, unterschiedliche Lernbedürfnisse haben und mit unterschiedlichen Kompetenzen eingeschult werden. Die Lösung für dieses Problem ist eine möglichst individuelle Lernerfahrung für jedes Kind.
Wenn nun Schüler:innen alle an den Herausforderungen arbeiten, die zu ihrem Lernstand passen, ergibt es keinen Sinn, sie gemeinsam zu prüfen und die Ergebnisse dann durch einen Notenvergleich auszugeben. Viel nützlicher sind ebenfalls individualisierte Rückmeldungen, die direkt in Lernprozesse eingebaut werden können.
Weshalb wehren sich nun Politiker:innen dagegen? Menschen, die in der Schule merken, dass sie individuelle Wege brauchen, werden diese auch im Berufsleben einfordern. Sie werden sich Arbeitsbedingungen nicht unterordnen, sondern gelernt habe, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und entsprechende Arbeitsumgebungen einfordern. Das ist eine riesige Chance für die Gesellschaft, aber eine Gefahr für eine Wirtschaft, die normierte, folgsame Arbeitskräfte möchte, die Menschen nicht als Menschen ansieht, sondern als Produktionsfaktor.
Was tun?
Schulen sollten der Politik nicht gehorchen, wenn sich das nicht mit ihrem pädagogischen Auftrag verbinden lässt. Gleichzeitig ist dieser Ungehorsam stressig und verbraucht viele Ressourcen. Ich würde Lehrpersonen und Schulleitungen raten, auf dem Papier Noten zu geben, damit aber möglichst wenig Aufwand zu verbinden und diese Noten möglichst niemandem zu zeigen. Es ist in vielen Fächern möglich, allen Schüler:innen eine 5.5 zu geben. So verlieren Noten an Bedeutung und behindern nicht die wertvollen Entwicklungen, welche die vom Notenzwang betroffenen Schulen durchlaufen haben.