Warum man Lernen und Leisten nicht trennen sollte
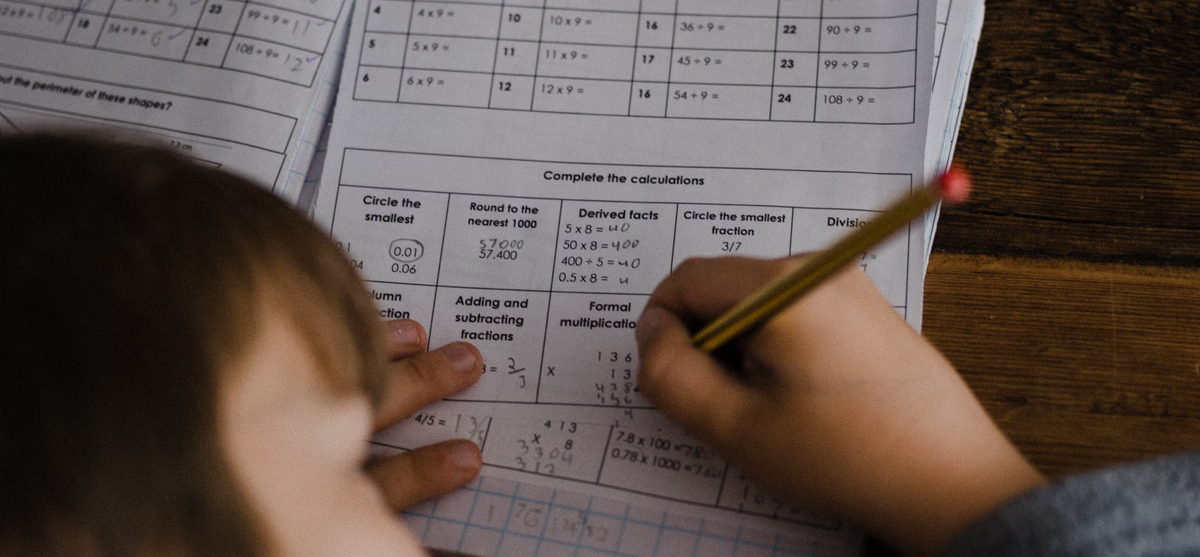
Im Rahmen der Kompetenzorientierung haben Didaktiker:innen wie Josef Leisen, Juliane Köster oder Ulf Abraham eine Differenzierung von zwei Aufgabentypen vorgenommen: Sogenannte »Lernaufgaben« dienen dazu, Wissen zu erwerben und Kompetenzen aufzubauen, während sogenannte »Leistungsaufgaben« so konzipiert sind, dass sich mit ihnen Wissenserwerb oder Kompetenzen überprüfen lassen (für eine Übersicht vgl. Luthiger 2012, S. 2 f.).
Diese Unterscheidung hat gravierende Folge für die Schulpraxis und für die Ausbildung von Lehr:innen: Diese gehen implizit oder explizit davon aus, dass Unterricht in zwei Modi aufgeteilt ist. Im Kompetenz-Modus liegt der Fokus auf der Entwicklung der Lernenden, auf ihrem Lernen. Dafür werden sogenannte »Lernaufgaben« eingesetzt. Im Performanz-Modus hingegen steht der Status im Vordergrund, Lernende kämpfen um einen Rang in der Klasse, ihr Ziel ist nicht eine Entwicklung, sondern symbolisches Kapital in der Form von Noten.
Diese beiden Modi lassen sich auf eine bildungssoziologische Doppelaufgabe von Lehrpersonen zurückführen (Luthiger 2012, S. 6 f.). Einerseits müssen sie Lernende fördern, andererseits müssen sie prüfen, um Allokation und Selektion betreiben zu können. Das ist ein fundamentaler Widerspruch im Rollenbild. Statt diesen Widerspruch aufzulösen, indem die meritokratische Aufgabe der Belohnung und Bestrafung je nach Leistung zurückgewiesen wird, schafft die begriffliche und funktionale Trennung von Lern- und Leistungsphasen im Unterricht eine Möglichkeit, die unterschiedlichen psychologischen Dynamiken von Lern- und Prüfungssituationen zu legitimieren.
So beantworten Lehrer:innen etwa im Kompetenz-Modus ständig Fragen von Lernenden. Sie ermuntern sie zur Zusammenarbeit und zur Reflexion, unterstützen sie mit Hinweisen, Materialien. Ein offener und mutiger Umgang mit Fehlern wird erwünscht, Fehler sind Lerngelegenheiten. Lernprozesse verlaufen unterschiedlich schnell und individualisiert. Im Performanz-Modus gelten all diese Regeln nicht mehr: Lernende müssen isoliert arbeiten, ohne Unterstützung der Lehrperson, ohne zusätzliche Materialien. Fehler werden angestrichen und führen zu Punktabzügen; alle bearbeiten dieselben Aufgaben innerhalb einem vorgegebenen Zeitfenster.
Werden Prüfungsaufgaben kritisiert, weil sie zu wenig offen oder nicht authentisch sind, dann lässt sich aus der Perspektive des Performanz-Modus argumentieren, es handle sich eben um »Leistungsaufgaben«, die gar nicht die Funktion hätten, offene Lösungswege oder authentische Problembearbeitungen zuzulassen. Wie bei der Meritokratie handelt es sich hier auch um ein Märchen für Erwachsene: Es blendet aus, dass die problematischen Prüfungsbedingungen Aufgabenformate erzwingen, die wesentliche Arbeitsformen aus dem Lernalltag und aus dem Unterricht verunmöglichen. Viele Lehrpersonen glauben an diese Erzählung, weil sie nicht akzeptieren können, wie problematisch ihre Beurteilungsfunktion für Schüler:innen ist und wie stark sie mit Bildungsgerechtigkeit verbunden ist.
Ein reflektierter Umgang mit Beurteilungs- und Prüfungskultur verschiebt den Fokus hin zu Lernaufgaben. Verantwortungsbewusste Lehrpersonen versuchen, Prüfungssituationen an den Kompetenz-Modus anzubinden, in dem Schüler:innen sich entwickeln können. Der Blick auf die Diskussion um die Unterscheidung von Lern- und Leistungsaufgaben kann hier deshalb hilfreich sein, weil sie zeigt, dass unter Umständen falsche Erwartungen erzeugt werden: Werden Noten generiert, dann arbeiten Schüler:innen anders, als wenn sie sich entwickeln dürfen, ohne dafür bewertet zu werden (Luthiger 2012, S. 7). Diese psychologische Einsicht kann nicht unterlaufen werden, indem die Unterscheidung von Lern- und Leistungsaufgaben unsichtbar gemacht wird oder Lernaufgaben dazu benutzt werden, Leistungen zu erheben.
Solange Menschen an individuelle Leistung und Meritokratie glauben, ist es schwierig, eine Schule zu gestalten, in der diese Gedanken die Prüfungskultur nicht beeinflussen. Oder anders formuliert:
Leistungsräume als Lerngelegenheiten nutzen zu können und zu wollen ist eine Kompetenz, die Lernende nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild als Teil der Gesellschaft bringt, vor allem aber Lernen bzw. transferfähige, handlungsleitende Erkenntnis und Selbstwirksamkeit gewährleistet. Das passive »Aushalten müssen« nicht sinnstiftender Prüfungen sollte von Reflexionsprozessen als Grundlage selbstbestimmter, lernwirksamer Fortentwicklung in sozialer Verantwortung abgelöst werden. Anna Reuter 2024. S. 86
Der Text ist ein leicht veränderter Auszug aus:
Wampfler (2024): Meritokratie und individuelle Leistung als Märchen für Erwachsene. In: ders./Langela/Dreier/Albrecht (Hg.): Wege zu einer zeitgemässen Prüfungskultur. Hamburg: Beltz (im Druck), S. 35ff.
