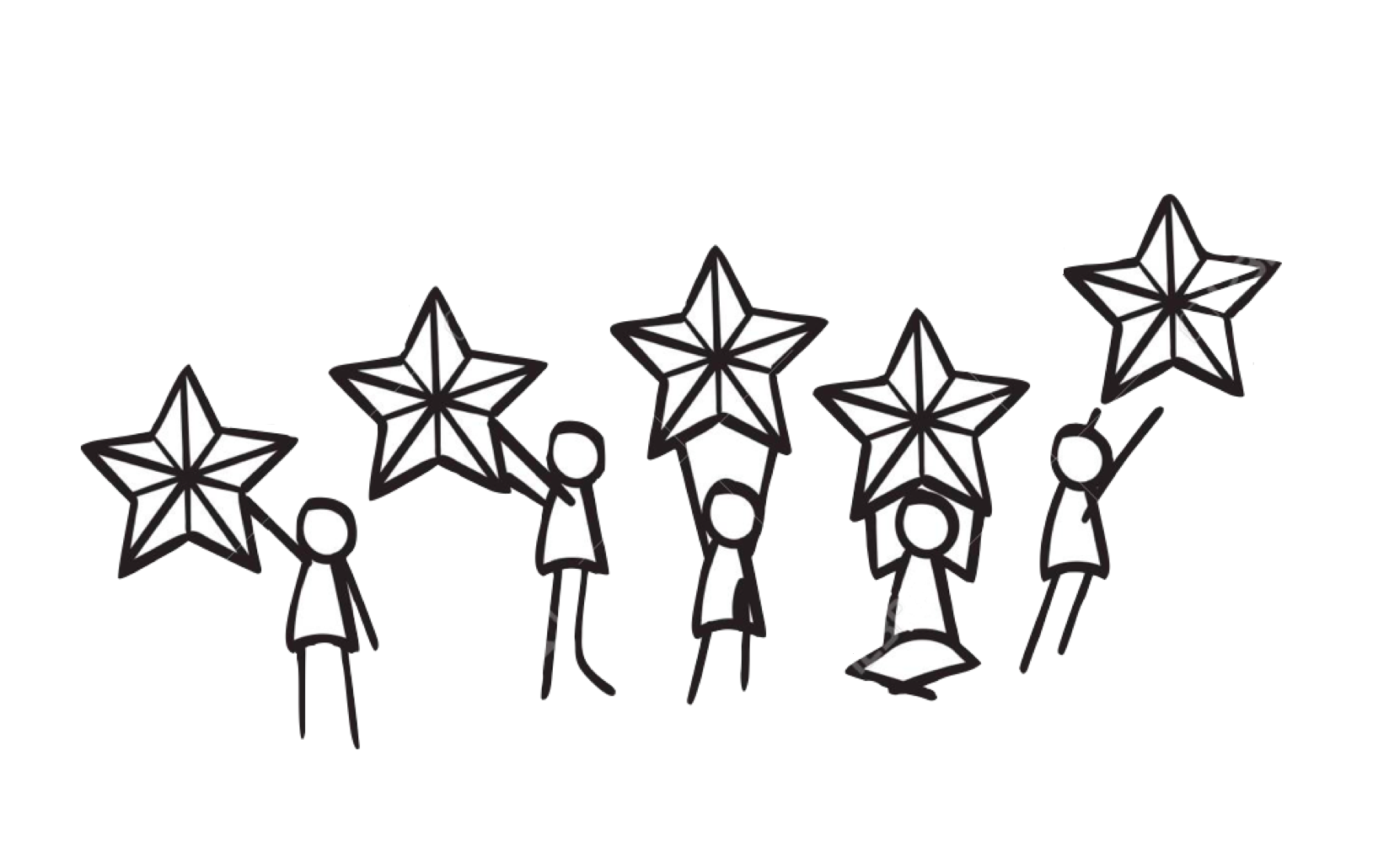Noten resigniert akzeptieren – zu einem Widerspruch vieler Lehrpersonen
Am letzten Samstag ist ein längeres Interview mit dem Erziehungwissenschaftler Roland Reichenbach erschienen (Paywall). Ich habe kürzlich schon einmal auf Thesen von ihm reagiert. Ich tue das noch einmal, weil ich finde, dass gerade der Zuspruch zahlreicher Lehpersonen zu diesem Interview einen grundsätzlichen Widerspruch verdeutlicht, den viele von uns mit sich zur Arbeit tragen.
Reichenbach sagt:
Bildung wird grösstenteils vererbt, auch in der Schweiz. […] Unserem modernen Schulsystem liegt das meritokratische Prinzip zugrunde. Wer mehr leistet, soll mehr erhalten. So legitimieren wir heute in der Schule auch die Selektion und damit die Schaffung und Rechtfertigung von ungleichen Zukunftschancen. Und da spielen die Noten eine zentrale Rolle.
[Frage: Sind Noten nicht ungerecht?]
Doch. Noten sind höchst problematisch, aber sie sind – in der einen oder anderen Form – unverzichtbar. Die Leistung muss gemessen, quantifiziert werden, um den Vergleich zwischen den Schülerinnen und Schülern rational erscheinen zu lassen. Ursprünglich sind Noten eingesetzt worden, um das System gerechter, das heisst demokratischer zu machen. Damit nicht die Herkunft, die Sympathie, die Macht oder das Geld darüber entscheidet, wer aufsteigt. […]
Die herrschende Pädagogik ist eine Pädagogik für Gewinner, also für jene, die zu Hause mitbekommen, dass sie in der Welt einen ordentlichen Platz erhalten.
Liest man das in dieser Form (ich habe nur wenig gekürzt), tritt der Widerspruch deutlich hervor: In der Realität ist das Schulsystem so gestaltet, dass privilegierte Eltern ihre Bildungsvorteile vererben können. Gleichzeitig gehen viele Menschen aber davon aus, dass das System Leistung belohne. Das geben auch Verantwortliche vor. Damit verschleiern sie das, worauf Reichenbach hinweist. Wir tun also Schüler:innen und ihren Eltern gegenüber so, als wäre der Vergleich von Schüler:innen «rational», tatsächlich entscheiden aber wirklich «die Herkunft, die Sympathie, die Macht oder das Geld».
Reichenbach kann dieses Problem diagnostizieren, er scheint aber nicht bereit zu sein, daran etwas zu ändern. Wir wissen: Noten sind ungerecht, sie reproduzieren Vorteile und Nachteile, mit denen Kinder ins Leben starten; sie verfestigen und vergrössern Unterschiede. Diese Einsicht würde von uns verlangen, etwas daran verändern, für Gerechtigkeit einzutreten. Viele Lehrpersonen können und wollen das aber nicht, gerade auch, weil sie Noten geben müssen. Sie suchen nach einem Weg, Noten zu rationalisieren und ihnen einen Sinn zu geben.
Wer das nicht kann, müsste dann so argumentieren, wie Reichenbach es tut: Noten sind «unverzichtbar», weil das System so nicht funktioniert. Lehrpersonen sind also grundsätzlich in der Situation, etwas Ungerechtes tun zu müssen – und stellen das dann als alternativlos, gar notwendig dar.
Für mich ist das eine schräge Form von Rationalisierung. Klar sind Noten tief im System verankert, Schüler:innen und Eltern erwarten sie, Übertritte und pädagogische Entscheidungen sind an Noten gebunden. Das bedeutet aber nicht, dass das so sein muss, dass keine anderen Lösungen denkbar sind. Wir können diese fundamentalen Ungerechtigkeiten nicht nur gemeinsam angehen, das ist auch unsere pädagogische Pflicht. Wie Reichenbach hinzunehmen, dass das Schulsystem Kinder benachteiligt, ist keine Option. Auch wenn es bequem wäre.