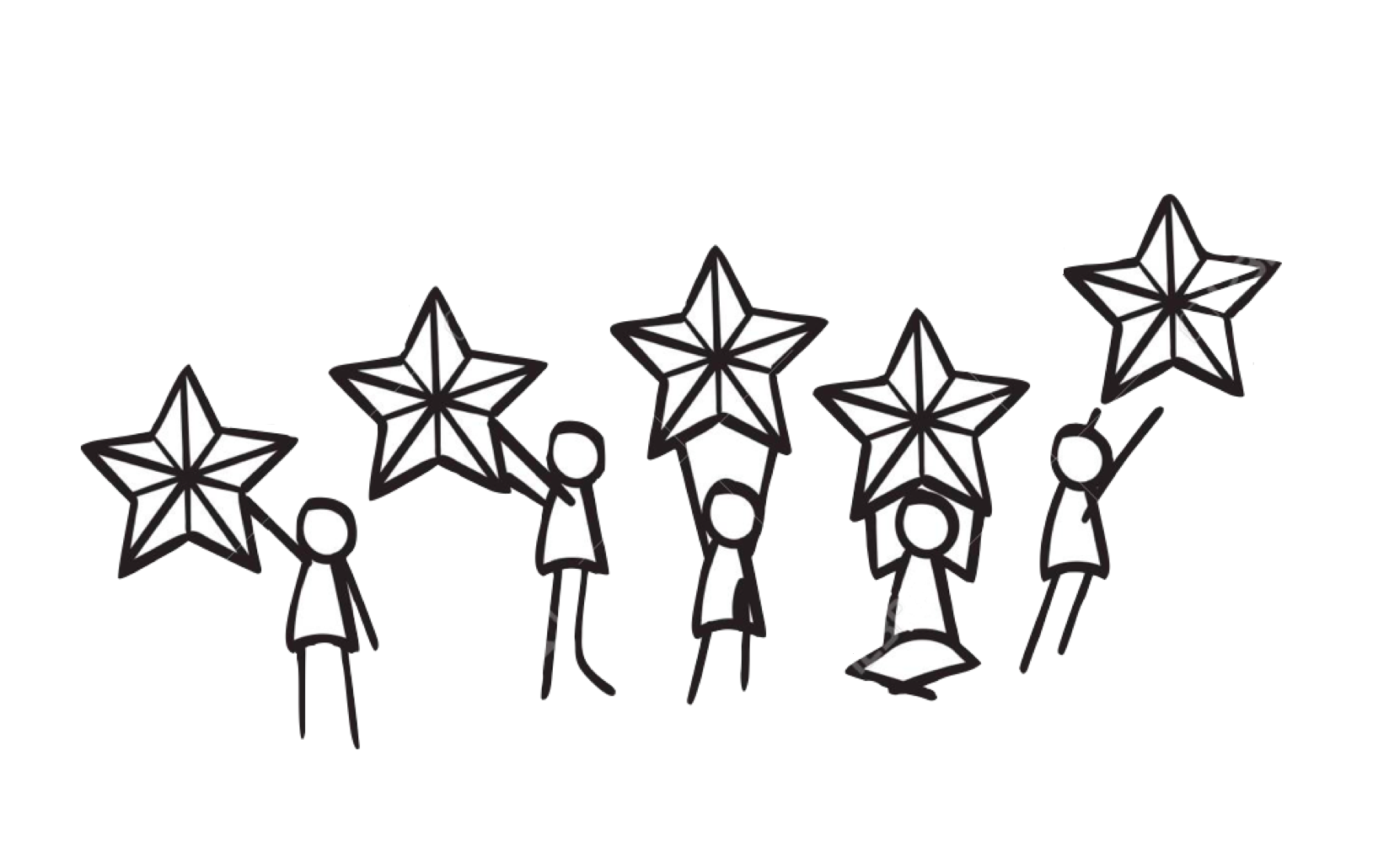Für eine umfassende Reform der Prüfungskultur
Ich habe diese Argumente für eine Debatte des Bayerischen Philologenverbands zusammengetragen – die Gegenseite wie den Originalbeitrag findet man hier. (Ich schreibe gerne Beiträge für solche Publikationen, es ist auch möglich, Posts aus diesem Newsletter dafür aufzubereiten.)
Prüfungen wurden und werden mit hohem Aufwand normalisiert. Wer lernt, braucht dafür keine Prüfungen. Kinder und Erwachsene erwerben täglich neue Kompetenzen, ohne dabei an Prüfungen zu denken. Gleichwohl können sich die meisten Menschen keine prüfungsfreie Schule vorstellen. Diese Normalisierung wirkt so stark, dass sie auch sanfte Veränderungsvorschläge einer Prüfungskultur als utopisch oder unsinnig erscheinen lässt. Dieser Beitrag plädiert für eine umfassende Reform der Prüfungskultur, welche diese Normalisierung grundsätzlich infrage stellt. Die etablierte Prüfungspraxis führt zu sechs Problemfeldern:
Erstens kommen Prüfungen immer entweder zu früh oder zu spät. Lernende werden in Prüfungssituationen gezwungen, auch wenn die dafür notwendigen Lernprozesse noch nicht abgeschlossen sind. Gleichzeitig beenden Prüfungen Lerneinheiten. In diesem Sinne kommen sie zu spät: Die damit verbundene Rückmeldung hat wenig Nutzen für Lernende. Prüfungen verhindern kontinuierliches, aufbauendes Lernen; sie begünstigen kurzfristige, wenig nachhaltige Verfahren.
Zweitens sind damit Fehlanreize verbunden. Schülerinnen und Schüler lernen weder für die Schule noch fürs Leben, sondern für die Prüfung. Dabei müssen sie schnell arbeiten, statt genau; sie schreiben bei Aufgaben unkritisch alles hin, was Punkte geben könnte. Lehrende und Lernende verengen ihre Anstrengungen stark, bis nur noch Prüfungen im Mittelpunkt potenziell vielfältiger, abwechslungsreicher Lernprozesse stehen. Das demotiviert.
Dieser dritte Aspekt wird stark unterschätzt, weil im Rahmen der Normalisierung von Prüfungen beteuert wird, sie würden die Motivation anheben. Das stimmt nicht - Prüfungen zwingen Lernende, sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht zu ihrer Entwicklung passen. Das ist keine Motivation. Prüfungen sind "Schüsse in den Ofen", heißt es im zentralen Aufsatz zur Motivationstheorie von Deci und Ryan: "Sie rufen nicht nur negative affektive Reaktionen hervor, sondern bewirken darüber hinaus auch ein qualitativ schlechteres Lernverhalten." Neben den negativen Emotionen, die mit Prüfungen verbunden sind, frustrieren auch die schlechten Ergebnisse: Zwei Drittel einer Klasse erhalten mittelmäßige bis schlechte Noten. Niemand lernt gern, wenn damit kaum Erfolge zu erzielen sind.
Demotivierend wirkt viertens auch der Vergleich mit anderen. Kinder vergleichen sich nur dann gern mit anderen, wenn sie den Eindruck haben, gut dastehen zu können. Wer kontinuierlich als weniger leistungsstark dargestellt wird, entwickelt eine Abneigung gegen Vergleiche. Das Lernen von Menschen kann und soll nicht verglichen werden, zumal jedes Verfahren dafür enorm ungenau ist. Zwar suggerieren die Zahlen, aus denen Noten bestehen, eine mathematische Präzision. Bei wissenschaftlicher Betrachtung erweist sich diese Genauigkeit als Illusion. Der Vergleich ist also nicht nur problematisch, sondern schlicht auch falsch.
Fünftens sind Prüfungen mit Allokation verbunden. Die Schule übernimmt die Aufgabe, Menschen bestimmten Berufsfeldern zuzuweisen. Wer gute Noten hat, darf studieren und gut bezahlte Berufe mit angenehmen Arbeitsbedingungen ausüben. Wer schlechte Noten hat, verdient schlecht und muss sich mit weniger attraktiven Berufen abgeben. Das wird mit Prüfungen als gerecht verkauft. Eine gute Schule fördert alle Kinder, sie ermöglicht ihnen Entwicklungen und schafft Chancen. Prüfungen verhindern Entwicklungen und zerstören Chancen.
Prüfungen sind sechstens lebensfremd. Sie orientieren sich an Aufgaben, die sich gut korrigieren lassen, nicht an Kompetenzen, die wichtig sind. Mut, Kritikfähigkeit, Resilienz, Solidarität, Empathie — das sind alles Kompetenzen, für die Schulen einstehen. Gegenstand von Prüfungen sind sie nicht. Das Wichtige wird nicht geprüft und das weniger Wichtige, das geprüft wird, wird mit so vielen Einschränkungen verbunden, dass letztlich eine Problembearbeitung erfolgt, die sich stark von der unterscheidet, die Menschen in Berufen und im Leben anwenden. Wenn Menschen unter Druck rechnen müssen, verwenden sie einen Taschenrechner, wenn sie wichtige Texte schreiben müssen, ein KI-Tool — wenn sie unsicher sind, sprechen sie mit anderen Menschen über die Probleme, die sie bearbeiten. All das darf man in einer Prüfung nicht, obwohl es sinnvoll wäre.
Bleibt die Frage nach der Alternative. Die Antwort liegt auf der Hand: An die Stelle von Prüfungen soll Feedback treten. Lernende brauchen Rückmeldungen, sie müssen wissen, wo sie stehen und was sie können. Prüfungen leisten dies nur unzureichend. Feedback hingegen funktioniert besser und wirkt nachhaltiger. Verbindlichkeit und Allokation hingegen müssen Menschen leisten, die Schülerinnen und Schüler begleiten und ihnen helfen, den richtigen Weg für ihre Entwicklung zu finden.