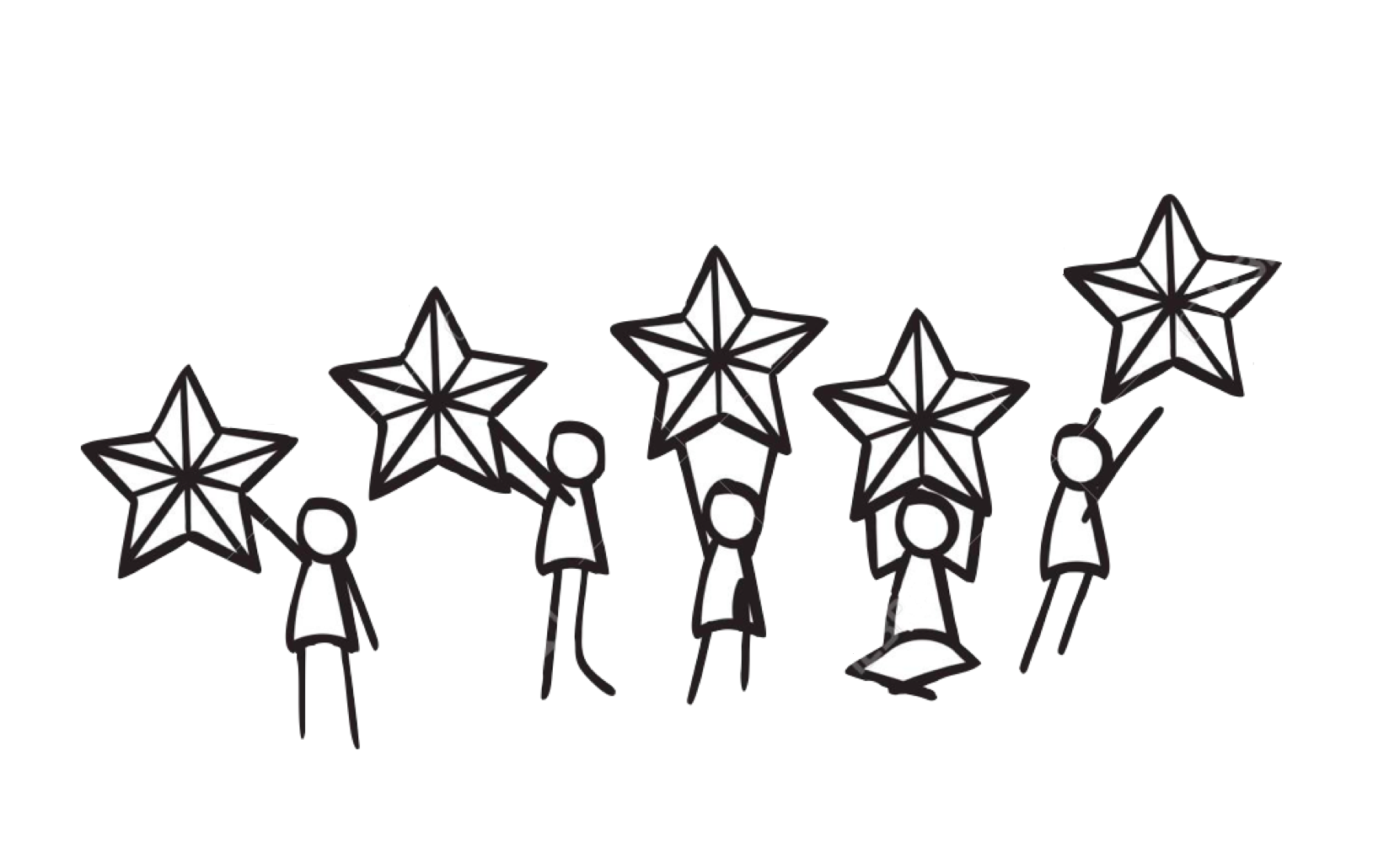Wozu braucht es Vorhersagen über Bildungserfolg? – eine Bemerkung zur Prognosevalidität
Die Durchschnittsnote im Maturitätszeugnis gilt als der valideste Einzelprädiktor für den Erfolg im anschliessenden Studium.
– Jürgen Oelkers
In akademischen Diskussionen über Noten werden oft viele Schwächen eingeräumt, die eine Bewertung mit Ziffern mit sich bringt – eine Stärke, die aber viele davon ausgleichen könne, sei die Prognosevalidität: Noten erlaubten besser als jeder andere Datenpunkt Schlüsse auf die Bildungszukunft von Schüler:innen. Ob das tatsächlich stimmt, lässt sich nicht so einfach überprüfen, viele Studien stammen aus spezifischen Bildungskontexten (z.B. Westrick et al. 2015) oder sind politisch direkt auf das deutsche Bildungssystem bezogen, in dem ein strenger Numerus Clausus Notendurchschnitte mit der Zulassung zu Hochschulstudiengängen verknüpft.
Damit ist die eigentliche Funktion dieses Arguments erwähnt: Wer sagt, Noten seien eine gute Basis um vorauszusagen, wie erfolgreiche jemand in späteren Studiengängen sein wird, impliziert, dass es diese Prognose braucht. Das ist nur der Fall, wenn Bildung nicht als Recht verstanden wird, sondern als knappe Ressource, die in einem Allokationsprozess verteilt werden muss. Gäbe es nicht genug Bildung, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, dann wäre es eine Möglichkeit, sie aufgrund von prognostiziertem Erfolg zu vergeben.
Neben dem Zweifel an der Aussage, Noten seien der beste Prädiktor von Bildungserfolge, und der Frage, ob Bildung überhaupt als knappes Gut betrachtet werden sollte (sobald es zu wenig gibt, können Staaten ja problemlos mehr zur Verfügung stellen), gibt es noch einen dritten Einwand gegen die Vorstellung von Prognosevalidität: Wie genau ist sie überhaupt?
Schüler:innen beziehen sich im Rückblick gern auf falsche Prognosen ihrer Lehrpersonen, die ihnen nach wenigen Jahren mitgeteilt hatten, es sei undenkbar, dass sie jemals Abitur machen oder studieren würden. Klar ist: Prognosen sind fehleranfällig. Es reicht nicht aus, wenn ein Prädiktor besser als andere ist, wenn es um die Zukunft von Menschen geht. Auch hier wird die Diskussion schnell unscharf, die Korrelationsdaten lassen sich schlecht in Werte umwandeln, die eine einfache Abschätzung erlaubten, wie genau Prognosen sind, die aus Noten abgleitet werden. Wir wissen lediglich, dass in einigen Untersuchungen der Zusammenhang zwischen Notenerfolgen in späteren und Notenerfolgen in früheren Schuljahren nachweisbar ist.
Vielleicht könnte man einfach gute Bildungsprozesse anbieten, ohne Menschen mit Prognosen zu belasten oder zu beschränken. Und Allokation weniger als eine zwingende Aufgabe ansehen, die man lösen muss, und eher als ein Problem, das beseitigt werden sollte.