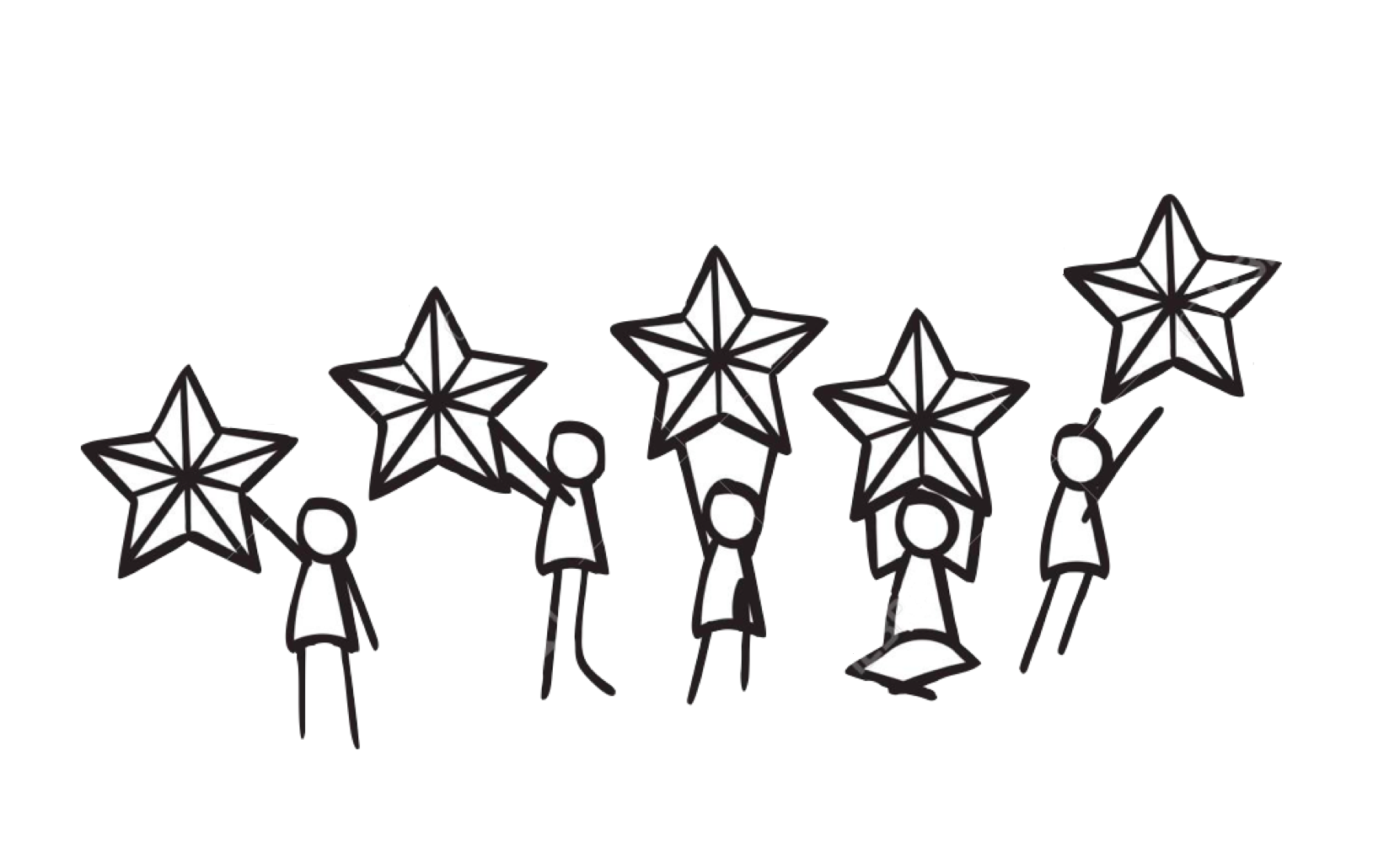Warum ✅/❌ besser ist als ein Notensystem
In einem Video (Dialekt) habe ich kürzlich dokumentiert, wie sinnlos es sich anfühlt, am Ende des Semesters Noten geben zu müssen. Wenn Schüler:innen für ihre Leistungen über ein Semester oder ein Schuljahr Zahlenwerte erhalten, dann vermischen sich viele Probleme:
- die Scheingenauigkeit von Noten (sie wirken genau, sind es aber nicht)
- die Beurteilungsfehler und Verzerrungen, welche die Notenvergabe beeinflussen (in der Schweiz sind Geschlecht, Erstsprache und Klassenstärke hier entscheidende Faktoren)
- der Vergleich von Schüler:innen untereinander, der sie primär unzufrieden macht, weil sich immer jemand finden lässt, der oder die mit scheinbar schlechteren Leistungen gleich gute oder bessere Noten erhalten hat
- die Tatsache, dass es statistisch nicht erlaubt ist, Noten zu Durchschnitten zu verrechnen
- die fehlenden Informationen, die hinter Noten liegen – so dass Aussenstehende wie Eltern oder Grosseltern allein aufgrund der Noten ihre Zufriedenheit mit der Schulperformance von Kindern und Jugendlichen ermitteln.
Das führt dazu, dass es sich enorm wichtig anfühlt, ob eine Note etwas besser oder etwas schlechter, obwohl es das nicht ist.
Die Alternative ist naheliegend: pass oder fail. Alle Schüler:innen, welche die Lernziele mehr oder weniger erreichen, bestehen das Fach, den Kurs, das Schuljahr. Alle, bei denen das nicht der Fall ist, werden begleitet und so unterstützt, dass sie in der nächsten Periode die Lernziele erreichen können: Vielleicht mit einer Repetition, mit einem Schulwechsel oder mit engerer Begleitung.
Letzte Woche habe ich auf einem Podium mit einem Lehrer gesprochen, der gesagt hat, er habe dieses System schon probiert: Die Schüler:innen wollten dann trotzdem wissen, welcher Note ihr ✅ oder ❌ entsprechen würde. Das ist einerseits verständlich, weil solche Systeme eine Weile brauchen, bis sie etabliert sind und funktionieren – andererseits aber auch ein Hinweis auf zu wenig Feedback: Genau wie Noten Feedback nicht ersetzen sollten (manchmal tun sie das aber leider), muss ein Pass-oder-Fail-System Rückmeldungen die Priorität einräumen. Schüler:innen, die genau wissen, was sie konkret erreicht haben oder noch nicht erreicht haben, brauchen keine Zahlenwerte. Hier kann man das Argument vieler Noten-Fans auf den Kopf stellen: Sie sagen oft, im Leben würde man auch bewertet. Das stimmt – aber nicht mit Noten. Sondern im Idealfall mit klaren, teilweise harten Rückmeldungen und Reaktionen. Die sollten auch Schüler:innen erhalten – aber ohne den unwissenschaftlichen Hokuspokus, den Noten darstellen. Durch Noten bilden sie sich ein, ein korrektes Assessment ihrer Leistungen zu erhalten, obwohl das so gar nicht erfolgen kann. Deshalb benutzen Erwachsene in ihrem Arbeitsalltag auch keine Noten: Weil sie nicht präzise sind und weil sie keine Informationen enthalten.